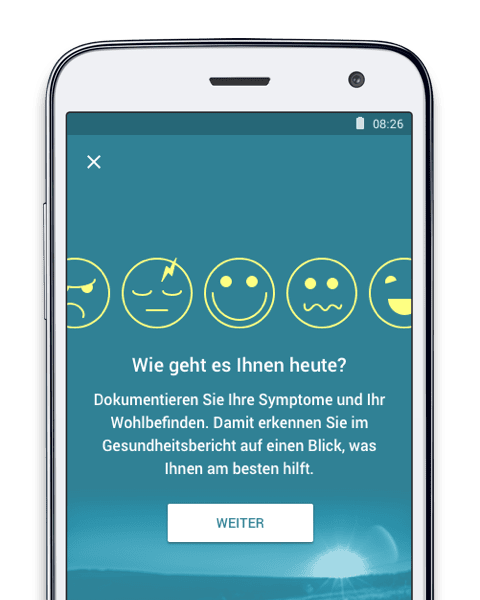Was ist eigentlich eine Dysthymie und wo liegt der Unterschied zu einer Depression oder einer depressiven Verstimmung? Bei Madeline wurde eine rezidivierende depressive Störung und Dysthymie festgestellt. Sie schreibt aus Erfahrung auf ihrem Blog „Learning to live“ darüber. Lesen Sie heute auf dem MyTherapy-Blog die Innenperspektive: Madeline teilt ihre Gedanken zum Thema Depression und zu ihrer Diagnose mit Ihnen.
Wir haben Madelines Blog in den Top Blogs 2020 vorgestellt:
Leben mit Depression: Diese 13 Blogger schreiben, was ihnen durch den Kopf geht
Jeden Morgen, wenn ich aufwache, atme ich so tief ein, wie es nur geht. Ich muss mich vergewissern, dass noch Luft hindurchpasst durch meine Atemwege, an dem riesigen Kloß in meinem Hals vorbei, hin zu den kleinen Alveolen der Lunge. Innerhalb der letzten Jahre habe ich viel Therapie gehabt, verschiedene Medikamente genommen und einiges über mich und meine Handlungsmöglichkeiten gelernt. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war wohl, dass mich dieses Kloßgefühl, dieses Zuschnüren der Kehle, nicht umbringen wird. Auch, wenn es sich immer mal wieder danach anfühlt.
Aller Anfang ist schwer: Der erste Schritt in die neue Richtung
Inzwischen sind mehr als fünf Jahre vergangen, seitdem ich mich das erste Mal in ärztliche Behandlung begeben habe, weil ich überfordert war mit dem Leben und diesen Anforderungen, die mir so unsagbar groß erschienen. Ich war sinnbildlich an der Spitze des Mount Everest angekommen, nur spiegelverkehrt, auf dem dunklen Klon, der nach unten ragte und auf dem die Luft ziemlich dünn wurde. Schon während meiner frühen Jugend merkte ich, dass etwas mit mir nicht stimmte, doch Zeit, so heißt es ja, heile alle Wunden. Also wartete ich jahrelang auf diese wundersame Besserung, bis schließlich nichts mehr ging und ich mich 2015 in einer psychiatrischen Tagesklinik wiederfand. Der Ort, an dem mein Leben in eine völlig andere Richtung gehen sollte.
Die Diagnose damals lautete: Schwere depressive Episode. Ich war verzweifelt, lebensmüde und nicht mehr in der Lage, die tägliche Last zu tragen, die so schwer auf meinen Schultern lag. In dieser Klinik wurde mir ein neuer Weg geebnet. Ich begann zu verstehen, was mit mir passierte und lernte, die Vergangenheit und die Gegenwart zu akzeptieren, ohne zu vergessen, dass ich immer noch Einfluss auf die Zukunft hatte. Man zeigte mir Strategien, mit denen es mir besser gehen konnte, und Wege, um gegen mein psychisches Leid anzukämpfen.
In den Jahren danach machte ich Fortschritte, habe gelernt, erlebt und verstanden. Ich war hoffnungslos und voller Hoffnung, entdeckte neue Perspektiven und verlor einige wieder, ich fand Worte und schwieg mich durch die Weltgeschichte. Ich war in Kliniken und machte ambulante Therapie, hatte Rückschläge, aber auch gute Momente, ich schloss neue Freundschaften und beendete ein paar alte. Es hatte sich viel verändert – und doch sind einige Dinge so furchtbar gleich geblieben, dass es mir Angst machte.
Unerfüllte Erwartungen, Frustration...
Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe erkrankt jeder fünfte Bundesbürger mindestens einmal in seinem Leben an einer Depression. Das ist eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss – gerade in Anbetracht der noch immer weit verbreiteten Sprachlosigkeit, wenn es um den gesellschaftlichen und privaten Diskurs von psychischen Erkrankungen geht. Und doch hat sich viel getan: Im Dschungel des Internets findet man Unmengen informativer Artikeln, Hilfestellungen und Berichte von medizinischem Fachpersonal und Betroffenen selbst. Und auch gibt es inzwischen unzählige Ratgeber für den Umgang mit einer Erkrankung, die sich in ihrer ganzen Individualität so schwer greifen lässt.

So positiv diese Entwicklung auch ist, so sehr wurde sie für mich auch zu einer Gefahr. Je mehr Zeit verging und je mehr ich über mich und psychische Erkrankungen im Allgemeinen lernte, desto verunsicherter wurde ich durch den Weg, den ich gegangen war und der Situation, in der ich mich noch immer befand; denn all die Dinge, die ich in der Therapie lernte, die ich mir mit Fachbüchern, Artikeln und Beiträgen von Betroffenen aneignete, ermöglichten mir zwar einen besseren Umgang mit den Symptomen der Depression, doch an meinen Gefühlen änderten sich nur Nuancen. Dieser innere Schmerz krallte sich wie eine Zecke an mir fest. Er war mal im Vordergrund, mal im Hintergrund, doch er war immer da.
"Ich fragte mich, ob 'Episode' nur ein Synonym für 'ganzes Leben' sei."
Das reichte mir nicht. Ich fragte mich, ob „Episode“ nur ein Synonym für „ganzes Leben“ sei oder ob ich einfach irgendetwas nicht richtig machte. Während Mitpatienten, zu denen ich noch in Kontakt stand, wieder arbeiten gingen, versuchte ich mich mit aller Kraft, therapeutischer Unterstützung und erlernten Hilfsstrategien lebenstauglich zu machen. Mir einen Alltag aufzubauen, an dem ich mehrere Tage hintereinander nicht verzweifelte. Ich brauchte ganz dringend eine Pause von dieser Schwere, die sich ganz tief in mir manifestiert hatte. Stattdessen fühlte es sich an, als hätte ich nur Einfluss auf die Umlaufbahn, nicht aber auf den Kern. Als hätte ich ein wackeliges Gerüst gebaut, doch das Fundament – der innere Schmerz – blieb derselbe.
Das Schlimmste daran war, dass ich es nicht verstand. Ich las verschiedene Geschichten über individuelle Erfolge im Kampf gegen die Depression, doch jeder Mutmacher erhöhte den Grad meiner Verzweiflung. Bis ich mich fragte, ob es an der Zeit war, die Hoffnungslosigkeit nicht als Symptom einer Krankheit, sondern als realistische Zukunftsaussicht zu betrachten. Bevor ich mich jedoch in diesen Gedanken versteifen konnte, entschied ich mich zu meinem Glück, ein zweites Mal in die Tagesklinik zu gehen, die mir einst das schenkte, was mir gerade ziemlich abhanden gekommen war: Hoffnung.
Double Depression – Ein Zusammenspiel aus Dysthymie und depressiver Episode
In der Tagesklinik diagnostizierte man mir zusätzlich eine Dysthymie. Die Kombination aus depressiver Episode und Dysthymie nennt man auch „Double Depression“.
Als „Double Depression“ (zu deutsch: Doppeldepression) versteht man das gleichzeitige Auftreten zwei verschiedener Arten der Depression, nämlich einer depressiven Episode und der Dysthymie. Die Dysthymie ist eine langanhaltende depressive Verstimmung und wird häufig als chronische Depression bezeichnet. Sie zeigt im Gegensatz zur depressiven Episode einen symptomatisch milderen Verlauf, der jedoch mehrere Jahre andauert.
Die Diagnose ließ mich in der ersten Reaktion zunächst einmal aufatmen, denn endlich konnte ich verstehen, warum mein Weg von den Erwartungen, die ich zuvor hatte, so sehr abgewichen ist. Ich konnte nachvollziehen, warum ich den Anfang und das Ende der depressiven Episode so schlecht bestimmen konnte und ich verstand, dass der tägliche Kloß im Hals etwas ist, für das es eine Erklärung, eine Begrifflichkeit gibt. Denn meine größte Angst war: Wenn man nicht verstand, was ich selbst nicht begriff, wie sollte man mir dann helfen können? Verzweiflung kann wirklich groß werden, wenn man das Gefühl hat, einem kann nicht geholfen werden.
Einstieg in die graue Welt – die Gefahren der Dysthymie
Die Dysthymie birgt eine besondere Gefahr: Sie führt die Betroffenen oftmals auf sanftere Art und Weise in eine Welt der Freudlosigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit. Sie kommt nicht so radikal daher wie eine depressive Episode, sondern ebnet oftmals unbemerkt den Weg dorthin und erzeugt bei vielen eine Art Gewöhnungseffekt, der das eigene Warnsystem überlistet. Viele Menschen, die ich im Zuge der Aufklärungsarbeit kennenlernte, beschrieben mir, dass die dauerhafte depressive Verstimmung ihnen Energie raubt, dass sie unter Schlafstörungen, Müdigkeit und Kopfschmerzen leiden und dass sie ihre Freude an den Dingen des Alltags verloren haben. Doch das, was sich da so eingeschlichen hat, war in vielen Fällen für die Betroffenen noch kein Grund, härtere Geschütze aufzufahren und sich Hilfe von außen zu holen. Anstatt dessen ist dieser Grauschleier ein schon fast zugehöriger Teil ihres Lebens geworden, mit dem sie noch „funktionieren“ konnten. Und so haben sich einige, so wie auch ich mich, irgendwann mitten in einer schweren depressiven Episode wiedergefunden, die eine bereits manifestierte depressive Verstimmung überlagert hat.
Die 5 wichtigsten Schritte, sich so gut es geht zu schützen
Rückblickend ist mir sehr bewusst geworden, auf was es ankommt, wenn man sich möglichst gut schützen und helfen möchte:
1. Aufmerksam sein
Der wichtigste erste Schritt, der sicherlich auch einer der schwierigsten ist: Beobachten und bewusst wahrnehmen. Es gibt immer mal wieder Phasen in unserem Leben, in denen die Trauer überwiegt. Solche Zeiten sind in einem bestimmten Rahmen etwas lebenszugehöriges. Sobald diese Phasen jedoch ungewöhnlich lange anhalten, sehr intensiv werden oder unseren Alltag auf längere Sicht massiv beeinflussen, ist es an der Zeit, einen ehrlichen Blick auf unsere mentale Gesundheit zu werfen, bevor sich etwas manifestiert, das mit der Zeit viel Schaden anrichten kann.
2. Verstehen
Das Verstehen beinhaltet auf der einen Seite, die Krankheit einzusehen. Nur, wer selbst erkennt, dass die Symptome keinen Anspruch auf Lebenszugehörigkeit besitzen, gibt sich auch selbst die Möglichkeit, Hilfen und Auswege sehen zu können.
Auf der anderen Seite ist es immer richtig und wichtig, möglichst umfangreich informiert zu sein und zu verstehen, was überhaupt mit einem passiert. Ich habe beispielsweise besonders darunter gelitten, nicht verstanden zu haben, warum ich nur in Tippelschritten vorankam. Seitdem ich weiß, was dahintersteckt, kann ich die Gegenwart leichter akzeptieren und die Zukunft besser beeinflussen.
3. Akzeptieren
In einem schlechten Moment habe ich in der Therapie einmal unter Tränen gesagt: „Ich will das aber nicht!“ Das Einzige, was mir das gebracht hat, war noch mehr Verzweiflung, Frustration und überhaupt kein Handlungsspielraum. Viele Menschen glauben, dass Akzeptanz eine Art der Resignation oder der Aufgabe ist, doch das Gegenteil ist der Fall: Erst das Akzeptieren des Status Quo bringt Potential zur Veränderung. Als ich gelernt habe, mir zu sagen, dass es jetzt gerade so ist, konnten wir viel aktiver und produktiver Strategien entwickeln, um den Zustand zu verändern.
Im Übrigen klingt Akzeptieren wesentlich leichter, als es ist. Viele Therapiekonzepte beinhalten deshalb auch das Thema „radikale Akzeptanz“. Es darf aber immer auch Momente geben, in denen man sich kurz und mit Händen und Füßen wehrt, solange man danach wieder zur Akzeptanz und damit zur Handlungsfähigkeit zurückfindet.
4. Handeln
Was man nicht versteht, lässt sich nur schlecht akzeptieren. Was man nicht akzeptiert, lässt sich auch kaum ändern. Und was sich nicht verändert, bleibt eben auch so, wie es ist. Das Paradoxon einer psychischen Erkrankung: was in der Therapie am wichtigsten ist, fällt Betroffenen oftmals leider auch am Allerschwersten – und zwar aktiv zu werden und nicht der Passivität und der Lethargie zu verfallen. Aktivität ist hier oft eine der größten Hürden, das Überwinden dieser aber ein wichtiger Teil in Richtung Besserung.
5. Geduld und Verständnis haben
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es nicht auch mal zu Rückschlägen oder Stillstand kommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade psychische Erkrankungen hoch-individuell sind. Es ist also durchaus erlaubt, auch mal rücksichtsvoll mit sich selbst umzugehen und Geduld aufzubringen. Eigene Erwartungen an die Realität anzupassen. Insbesondere in unserer schnelllebigen, digitalisierten und leistungsorientierten Welt, in der es viel um Vergleiche geht, ist es kein schönes Gefühl, die eigenen Erwartungen nicht erfüllen zu können oder von dem ursprünglichen Weg abzuweichen. Ein bewusster Umgang mit den eigenen Gefühlen sowie Verständnis und Nachsicht für seine Situation aufzubringen ist wichtig, um sich nicht selbst im Weg zu stehen und Hürden nicht dort aufzustellen, wo keine sein müssen.
Letzten Endes gibt es kein Patentrezept. Es gibt nicht den einen Weg, der richtig ist und das eine Tempo, das funktioniert. Und auch gibt es keine Garantie dafür, wann und ob man wieder richtig frei durchatmen kann. Aber es gibt immer und überall die Möglichkeit, sich jene Voraussetzungen zu schaffen, um mit etwas so gut es eben geht fertig zu werden. Diese Chance ist immer da – egal, an welchem Punkt man sich auch befindet.
Das könnte Sie außerdem interessieren: